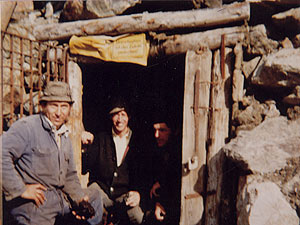Seit
dem großen Murenabgang im August 2002, bei dem das Gasthaus
Alpenrose verschont blieb, ist es für jedermann leicht möglich,
Smaragde ohne große Anstrengungen zu finden. Natürlich liegen
die Edelsteine nicht vor den Füßen und es braucht genauso
viel Geduld und Ausdauer wie früher, wenn man ein grünes Steinchen
in den Händen halten will.
Das Gasthaus Alpenrose kann man
zu Fuß vom Parkplatz in Habach
(ca. 2 km westlich von Bramberg) in etwa 1,5 Stunden erreichen. Wer es
bequemer haben will, kann auch das Taxi der Firma Innerhofer in Anspruch
nehmen. Zwischen 8,00 und 8,30 Uhr fahren Busse ins Tal, um 17 Uhr kann
man wieder mit dem Taxi zurückkehren.
Es ist ratsam, die Ausrüstung
sorgsam zu wählen. Gutes, wasserabweisendes
Schuhwerk (ev. auch Gummistiefel) sind die Voraussetzung für die
ausdauernde Suche, denn man steht häufig im kalten Wasser des Leckbaches.
Zusätzlich trägt man im Rucksack auch Jause, Getränk,
Regenschutz und ein Erste-Hilfe-Paket mit.
Dann muss man unbedingt ein
Metallsieb mitführen (oder sich beim
Wirt des Gasthauses Alpenrose eines ausleihen und auch wieder dort zurückgeben)
(Maschengröße etwa 3 mm), denn die Smaragde liegen im sandigen
Schutt des Baches und müssen heraus gewaschen werden. Um das Material
hinter dem Sieb zu lockern, braucht man eine Haue oder einen Pickel.
Für den Notfall tut es auch ein alter Eispickel (der kurze Stiel
wird aber Kreuzschmerzen verursachen). Mit einer Maurerkelle oder einem ähnlichen
Gerät zieht man das gelockerte Material über das Sieb, über
das auch Wasser fließen muss. Das Sieb soll so eingebaut sein,
dass eine passende Wassermenge das Material ausschwemmt und dass vor
allem nichts daneben oder dahinter abfließt (es könnten sonst
Smaragde verloren gehen). Danach kann die Feinsuche beginnen. Mit der
Kelle zieht man eine dünne Materialschicht über das gesamte
Sieb, sodass das Wasser die Schmutzteile sofort ausschwemmt und man das
Grün eines Smaragdes nicht übersieht. Große Steine werden – sofern
es sich nicht um Glimmerschiefer (= Muttergestein der Smaragde) handelt – händisch
entfernt, ohne dass man dabei den in der Nähe Siebenden gefährdet.
Smaragde kann man meist ganz schnell erkennen, nur manchmal täuscht
grünes Serpentingestein, ein Teil eines Strahlsteines oder ein Grashalm
den eifrig Suchenden. Findet sich kein Smaragd in der gewaschenen Schicht
(das kommt auch vor), so streift man dieses taube Gestein über das
Sieb. Dann wiederholt man diesen Vorgang und mit der Zeit wird sich der
ein oder andere Erfolg einstellen. Immerhin wurden schon großartige
Funde auf diese Weise getätigt.
Besonderes Augenmerk sollte man
aber den Glimmerschieferbrocken widmen, denn die können Smaragde
in sich bergen. Feiner, grauer, tektonisch beanspruchter Glimmerschiefer
führt am ehesten schöne Smaragde.
Genauso kann aber auch brauner, schwarzer und talkig-weißer Glimmerschiefer
Smaragde enthalten. Solche Steine zerschlägt man vorsichtig mit
Hammer und Meißel. Damit man die Smaragdkristalle nicht verliert,
nimmt man am besten ein verschließbares Döschen mit (ev. Filmrolle),
denn im Hosensack verschwinden sie unweigerlich.
Immer
wieder einmal wird auch ein Pyritwürfel auf dem Sieb zu
finden sein. Diese sind meist würfelig, goldglänzend und manchmal
auch braun oxydiert. Auch in Gneisfelsen kann man Pyrite beobachten,
diese zerschlagen und mit etwas Glück findet sich eine prächtige
Pyritstufe.
Neben dem beschriebenen Werkzeug sollte man noch Zeitungspapier
mitnehmen, damit man die Smaragd-, Pyrit- oder Aktinolithstufen (= Strahlstein)
schonend nach Hause tragen kann. Will man dem ursprünglichen Smaragdvorkommen
in einer ungefähren
Seehöhe von 2200 m näher kommen, so kann man auch auf die eben
beschriebene Art und Weise im Blockschutt des sogenannten „Sedls“ (knapp
oberhalb der Waldgrenze auf der linken Seite des Steiges) nach Smaragden
graben. Man folgt dem gut sichtbaren Steig auf der rechten Seite des
Leckbaches von der Alpenrose aus. Die Gehzeit beträgt gut eine Stunde.
Das Gelände dort ist steiler und birgt somit alpine Gefahren. Dennoch
ist ein Aufstieg allein schon wegen der schönen Bergwelt lohnend.
Die Chancen Smaragde zu finden sind etwa gleich groß wie auf der
Mure neben der Alpenrose.
Der Aufstieg zum Smaragdbergwerk (ca.2,5 Std.
vom Gasthof Alpenrose) ist eigentlich nicht empfehlenswert. Das Gelände
in der Leckbachrinne ist sehr steil und durch das ständige Arbeiten
verschiedener Leute kommt es immer wieder zu (teils heftigem) Steinschlag.
In den letzten Jahren kamen auch große Massen von Gestein vom Nasenkopf
und eigentlich ist es verwunderlich, dass es hier noch kein ganz großes
Bergunglück
gegeben hat. Zudem ist unterhalb des Bergwerks das Gestein durch den
Talkanteil extrem rutschig und glitschig. Das Bergwerk kann man ohnehin
nicht betreten, denn das Sicherheitsrisiko wäre viel zu groß.
Interessiert man sich für Smaragde und Mineralien des Habachtales,
so kann man sich eingehend und umfassend informieren:
Tourismusbüro
Bramberg
Museum Wilhelmgut
Bramberg
Private Mineraliensammler
Mineralienführungen
Literatur
Internet
Der Bereich der Leckbachrinne mit dem Smaragdvorkommen liegt zwar im
Nationalpark Hohe Tauern, befindet sich aber nicht in der Kernzone (sondern
in der Außenzone). Somit kann man hier nach Steinen suchen.
In
der Kernzone (der größte Teil des Habachtales liegt in
der Kernzone) gelten strenge Auflagen und das Steinsuchen ist dort grundsätzlich
untersagt. Eine Genehmigung wird nicht erteilt. (Genaue Auskünfte
gibt die Nationalparkverwaltung)
Auf jeden Fall bitten wir inständig
um einen sorgsamen Umgang mit der Natur. Es sollte kein Müll oder
Abfall, kein gebrochenes Werkzeug, kein Eimer oder Sieb zurückgelassen
werden. Unterlassen Sie auch massive Erd- oder Steinbewegungen. Grobes
Werkzeug (Bohrhämmer,
Schläuche, ....) darf nicht verwendet werden. Außerdem ist
das Biwakieren oder die Übernachtung im Zelt nicht gestattet. Das
wird auch von den Nationalparkwarten überprüft und kann eine
Verwaltungsstrafe nach sich ziehen.
Verhält man sich aber entsprechend,
dann ist die Smaragdsuche eine ausgesprochen spannende Sache. Besonders
Kinder finden großen
Spaß an der Schatzsuche.
Man darf trotz aller Spannung nicht vergessen,
dass man sich im alpinen Gelände befindet und dort die alpinen Gefahren
nicht zu unterschätzen
sind (Wetterumschwünge,
Steinschlag, ...).
Wichtige Adressen
| |
Tourismusbüro Bramberg
Stoitznergasse 3, 5733 Bramberg; Tel: 06566/7251 |
| |
Gasthaus Enzian im Habachtal
Fam Alois Blaikner,
Schönbach 2, 5733 Bramberg;
Tel: 06566/7383
|
| |
Gasthaus Alpenrose im Habachtal
Fam. Manfred Egger, Wenns 90, 5733 Bramberg; 06566/8670
|
| |
Taxi Innerhofer, Bramberg
Walter Innerhofer,
Sportstraße 226,
5733 Bramberg, Tel:06566/7451
|
| |
Nationalpark Hohe Tauern
Nationalparkverwaltung,
Sportplatzstraße 306, 5741 Neukirchen;
Tel: 06565/6558
|
Erwin Burgsteiner
Geschichtliches zum Habachtaler Smaragdvorkommen:
Es wird berichtet, dass bereits die Römer im Habachtal Smaragde
schürften. Dies ist nicht zweifelsfrei zu belegen. Wahrscheinlich
wurden Smaragde von den Einheimischen über Jahrhunderte
nicht gezielt gesammelt, sondern nur wegen ihrer schönen Farbe aufgehoben,
wenn sie sich an der Erdoberfläche befanden.
1669 erwartete Prinzessin
Anna di Medici vom dänischen Gelehrten
Niels Stensen einen Bericht über die Smaragdgruben im Habachtal.
Als die wohlhabende Senningerbräuerin Maria Rottmayr 1732 starb,
waren in ihrem Nachlass zwei Goldringe mit Smaragden aus dem Habachtal.
1797 hat Schroll den Fund einer kleinen dunkelgrünen Säule
beschrieben, die er beim Zerschlagen eines Glimmerbrockens entdeckte.
1821 beschrieb der Mineralienhändler J. Frischholz ausführlich
das Smaragdfundgebiet im Habachtal.
1829 machte Bergdirektor Mielichhofer
einen Smaragdfund in der Sedlalpe.
1859 veröffentlichte Zepharovich
im Mineralogischen Lexikon Österreichs
genauere Angaben über das Smaragdvorkommen. Daraufhin wurde das
Gebiet genauer abgesucht; es wurden mehrere schöne Steine gefunden.
1862 veranlassten Samuel Goldschmidt diese viel versprechenden Funde
dazu, das ganze Gebiet zu kaufen. In über 2000m Höhe ließ er
das Berghaus errichten und unterhalb der Legbachscharte wurden mehrere
Stollen in den „Smaragdpalfen“ getrieben.
Die Ausbeute soll gut gewesen sein.
Nach dem Tod von Goldschmidt (1871)
wurde der Abbau vorübergehend
eingestellt.
In den Folgejahren übernahm die englische Gesellschaft
Limited Forster das Bergwerk und beschäftigte 30 Knappen, die den
Abbau mit gutem Erfolg betrieben.
1896 kam die Emerald Mines Ldt. aus
London in den Besitz der Gruben.
1913 musste der Betrieb wegen hoher
Schulden, die durch einen schlechten Verwalter angehäuft wurden,
eingestellt werden.
Die Gemeinde Bramberg kaufte das gesamte Areal relativ
günstig,
da noch ein beträchtlicher Teil an Gemeindesteuern ausständig
war.
1917 konnte der Sägerwerksbesitzer Anton Hager aus Traunstein
das Bergwerk erwerben. Aber auch ihn zwangen wirtschaftliche Schwierigkeiten
(1. WK- Wirtschaftskrise) die Mine 1927 zu verkaufen.
Nach der deutsch- österreichischen
Edelsteinbergwerksgesellschaft und der schweizerischen Gesellschaft für
modernen Bergbau kam das Bergwerk schließlich in den Besitz von
Justizrat Max Gaab aus München.
1938 wurde Österreich von der
Landkarte gestrichen – die
Besitzverhältnisse dieser Zeit sind verworren.
Nach dem Krieg bewarb
sich Oberst Zieger bei den amerikanischen Besatzungsmächten
um den Posten des Minenverwalters.
Er war von 1945 bis 1949 im Bergwerk
tätig und verschliff die
gefundenen Steine selbst.
Auf Zieger folgten Hubicky und das Duo Caha-
Eberl.
1963 erfolgte die offizielle Rückstellung des Bergwerks an
den Rechtsanwalt Karl Gaab. Seine Aufsichtspersonen am Bergwerk und in
der Goldschmidthütte waren über viele Jahre Studenten aus München.
1975 bewarb sich Sebastian Berger gemeinsam mit Klaus Wenzel und Heinrich
Hammerle bei Gaab um den Aufsichtsposten.
Streitigkeiten und gegenseitiges
Misstrauen beim Fund von außergewöhnlich
großen Phenakiten führten bald dazu, dass sich die drei trennten
und Berger ab 1976 die alleinige Aufsicht hatte. Er sicherte die Stolleneingänge
mit Eisentüren, ließ per Hubschrauber einen Wohnwagen in die
unmittelbare Nähe des Bergwerks schaffen und trieb viele Meter Stollen
in den Berg.
Die etwa 10 Jahre dauernde Ära Berger war sowohl für
Funde als auch für die wissenschaftliche Erforschung ergiebig verlaufen.
1986 beging Berger, der schon jahrelang psychische Probleme hatte, auf
tragische Weise Selbstmord.
Alois Steiner und Alois Hofer, beide Mineraliensammler
aus Bramberg, wurde ab 1986 der Aufsichtsposten übertragen. Die
sich bereits in einem sehr schlechten Zustand befindliche Goldschmidthütte
wurde unter großem Aufwand hergerichtet und dient seither wieder
als Unterkunft für die Bergwerkspächter.
Der Abbau im Berg
erwies sich durch die sehr labilen Gesteinsschichten und durch mangelhafte
Pölzung als überaus schwierig und es
musste viel Zeit und Energie aufgewandt werden um den bestehenden Stollen
zu sichern. Der Erfolg durch gute Funde lässt aber in den Anfangsjahren
auf sich warten und Alois Hofer steigt aus.
Seit Anfang der neunziger Jahre ist die Familie Steiner alleiniger
Pächter des Smaragdbergwerks und betreibt den Abbau mit Erfolg.
Nur durch hervorragendes Fachwissen, das für die Stollenführung
nötig ist, besteht die Möglichkeit, noch nicht ausgebeutete
Bereiche im Innern des Bergesaufzuspüren. Da wirklich gute Steine
sehr rar sind und leider nur selten gefunden werden, ist es hilfreich,
dass auch Smaragde von minderer Qualität im eigenen Mineralienhandel
vermarktet werden können.
Dies bildet die Grundlage, um wirtschaftlich arbeiten zu können.
Erich
Mosser
|
 Der mittlere Teil
der Leckbachrinne Der mittlere Teil
der Leckbachrinne
 Der obere Teil der
Leckbachrinne mit dem Eingang zum Bergwerk - siehe Rechteck Der obere Teil der
Leckbachrinne mit dem Eingang zum Bergwerk - siehe Rechteck
 Bergwerkseingang Bergwerkseingang
 Der mittlere Teil
der Leckbachrinne, rechts im Hintergrund der Nasenkopf, links das Goldschmidthaus
- siehe Rechteck Der mittlere Teil
der Leckbachrinne, rechts im Hintergrund der Nasenkopf, links das Goldschmidthaus
- siehe Rechteck
 Im Sedl- unterer Teil der
Leckbachrinne Im Sedl- unterer Teil der
Leckbachrinne
 Jetzt wird es interessant ... Jetzt wird es interessant ...
 Die Farbe passt! Die Farbe passt!
 Schau genau! Schau genau!
 Das "Sedl" mit Blickauf den Graukogel Das "Sedl" mit Blickauf den Graukogel
 Im untersten Teil des Sedls, im Leckbachklamml Im untersten Teil des Sedls, im Leckbachklamml

Bilder:
Mosser Erich
Scheiterbauer Kurt
Historische Aufnahmen:
 Das Goldschmidthaus Das Goldschmidthaus
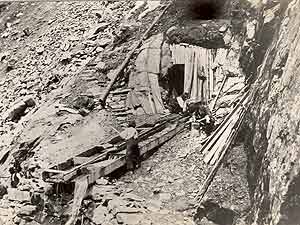 Smaragdbergwerk- Waschanlage beim C-Stollen Smaragdbergwerk- Waschanlage beim C-Stollen
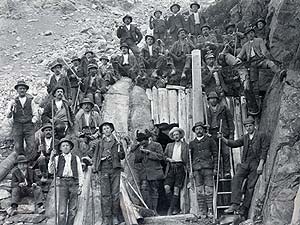 Knappen beim Stolleneingang - um 1908 Knappen beim Stolleneingang - um 1908
 Wasserleitung zum unteren Stollen Wasserleitung zum unteren Stollen
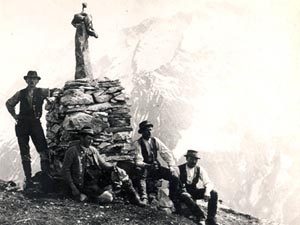 Auf dem Nasenkopf oberhalb des Goldschmidthauses Auf dem Nasenkopf oberhalb des Goldschmidthauses
 Gasthof Alpenrose
um 1920 Gasthof Alpenrose
um 1920
 Hans Zieger beim
Smaragdschleifen - um 1950 Hans Zieger beim
Smaragdschleifen - um 1950

Smaragdsucherromantik in den 70-igern
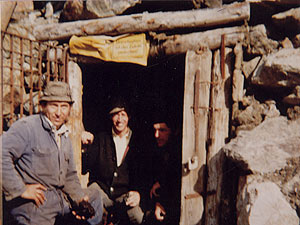
Sebastian Berger 1979
Bilder : Archiv Burgsteiner Erwin
|
 Der mittlere Teil
der Leckbachrinne
Der mittlere Teil
der Leckbachrinne  Der obere Teil der
Leckbachrinne mit dem Eingang zum Bergwerk - siehe Rechteck
Der obere Teil der
Leckbachrinne mit dem Eingang zum Bergwerk - siehe Rechteck  Bergwerkseingang
Bergwerkseingang Der mittlere Teil
der Leckbachrinne, rechts im Hintergrund der Nasenkopf, links das Goldschmidthaus
- siehe Rechteck
Der mittlere Teil
der Leckbachrinne, rechts im Hintergrund der Nasenkopf, links das Goldschmidthaus
- siehe Rechteck  Im Sedl- unterer Teil der
Leckbachrinne
Im Sedl- unterer Teil der
Leckbachrinne  Jetzt wird es interessant ...
Jetzt wird es interessant ...  Die Farbe passt!
Die Farbe passt!  Schau genau!
Schau genau!  Das "Sedl" mit Blickauf den Graukogel
Das "Sedl" mit Blickauf den Graukogel  Im untersten Teil des Sedls, im Leckbachklamml
Im untersten Teil des Sedls, im Leckbachklamml
 Das Goldschmidthaus
Das Goldschmidthaus 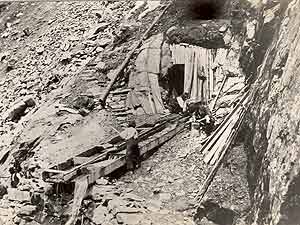 Smaragdbergwerk- Waschanlage beim C-Stollen
Smaragdbergwerk- Waschanlage beim C-Stollen 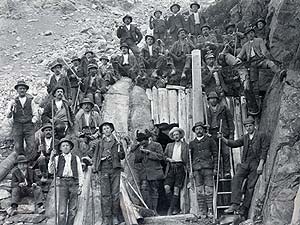 Knappen beim Stolleneingang - um 1908
Knappen beim Stolleneingang - um 1908  Wasserleitung zum unteren Stollen
Wasserleitung zum unteren Stollen 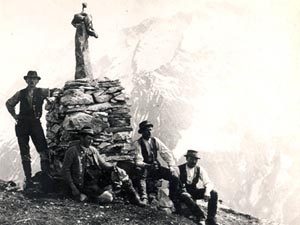 Auf dem Nasenkopf oberhalb des Goldschmidthauses
Auf dem Nasenkopf oberhalb des Goldschmidthauses Gasthof Alpenrose
um 1920
Gasthof Alpenrose
um 1920  Hans Zieger beim
Smaragdschleifen - um 1950
Hans Zieger beim
Smaragdschleifen - um 1950